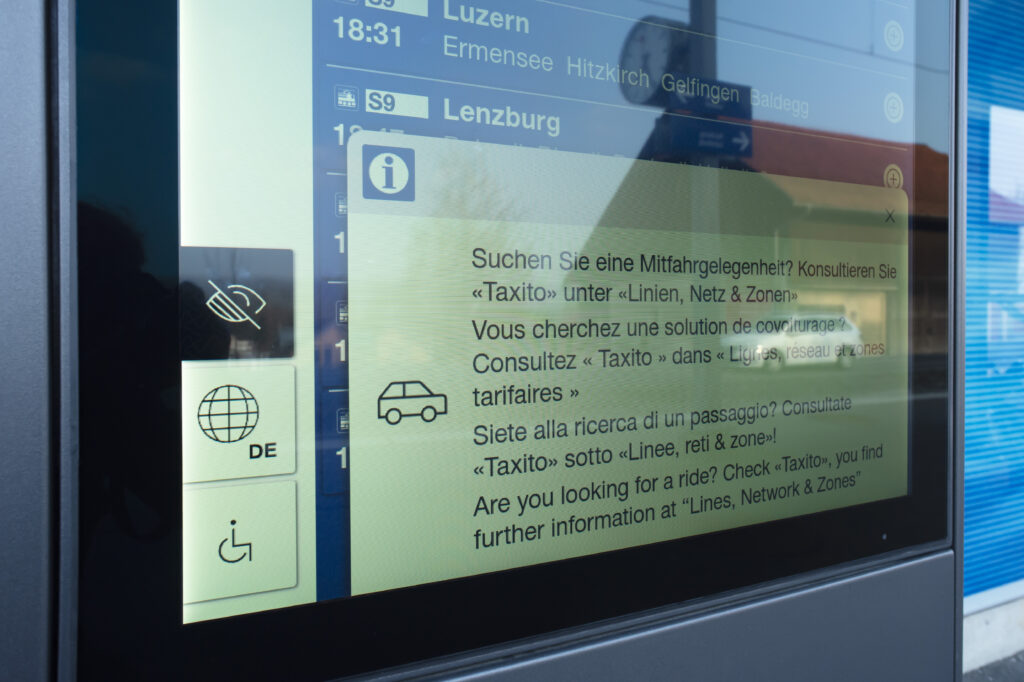Für viele Tourismusdestinationen ist das Wintergeschäft überlebenswichtig. Aufgrund des Klimawandels ist jedoch selbst mit technischer Beschneiung vielerorts mit kürzeren Wintersaisons zu rechnen. Eine Reihe von aktuellen Projekten, unterstützt vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) im Rahmen der Förderinstrumente Neue Regionalpolitik (NRP), Interreg und Innotour, begleiten Destinationen bei der Anpassung an den Klimawandel.
Ein weisses Band umgeben von grün-braunen Wiesen. An diesen Anblick mussten sich viele Skigebiete in den letzten Jahren gewöhnen.Die Anzahl Schneetage hat sich seit 1970 unterhalb von 800 m halbiert und auf 2000 m um 20 % reduziert. Das ist die ernüchternde Bilanz der bisherigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Schneebedeckung in der Schweiz. Gemäss den Klimaszenarien von MeteoSchweiz wird diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitergehen. Insbesondere für Skigebiete unterhalb von rund 1500 m (Seilbahnen Schweiz, 2024) dürfte es zunehmend schwierig werden, einen rentablen Skibetrieb aufrecht zu erhalten. Dies nicht nur aufgrund der steigenden Schneefallgrenze, sondern auch aufgrund der Abnahme der Anzahl Tage, die kalt genug für die technische Beschneiung sind. So hat sich beispielsweise in Engelberg auf 1037 m die Anzahl Eistage, an denen die Maximaltemperatur unter 0° C liegt, seit 1970 fast halbiert – von ca. 40 Tagen auf knapp über 20 Tage (MeteoSchweiz, 2024). Zu den klimatischen Veränderungen hinzu kommt auch die zunehmende internationale Konkurrenz sowie die demografische Entwicklung. Insgesamt hat dies zu einer schweizweiten Abnahme der Eintritte in Skigebiete (Skier-days) von über 30 % seit Anfang der 1990er Jahre geführt (Seilbahnen Schweiz, 2024c).Die im Folgenden vorgestellten Projekte zeigen Prozesse und Lösungsansätze auf, wie Tourismusdestinationen mit Schneemangel umgehen können und welche Chancen und Risiken es dabei gibt.
Innotour-Projekt «Kompass Schnee»: Schneesicherheit im sich erwärmenden Klima
Seilbahnen Schweiz hat zusammen mit dem Verein Schweizer Tourismusmanagerinnen und Tourismusmanager und Schweiz Tourismus das Projekt «Kompass Schnee» lanciert. Das Projekt wird gefördert durch Innotour und hat zum Ziel, Tourismusdestinationen im Umgang mit den sich verändernden Schneebedingungen zu unterstützen. Basierend auf aktuellen Klimadaten und -projektionen und in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich und dem Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF), entwickelt das Projekt ein Werkzeug für Wintersportregionen der Schweiz, um ihre aktuelle und zukünftige Schneesicherheit einzuschätzen und Massnahmen abzuleiten. Dazu gehören Optimierungen des Wintersportangebots beispielsweise durch technische Beschneiung und Veränderung der Saisondauer aber auch vermehrtes Setzen auf schneeunabhängige Angebote wie Kultur und Gastronomie. Ein Factsheet zu den Klimaszenarien für den Winter 2050 ist bereits verfügbar (Seilbahnen Schweiz, 2024). Das Projekt Kompass Schnee läuft von 2024–2026 und im Sommer 2025 sind weitere öffentliche Resultate zu erwarten (Seilbahnen Schweiz, 2024b).
Interreg-Projekt «Beyond Snow»: Weg vom reinen Wintertourismus
Viele Wintersportgebiete, die unterhalb von ca. 1500 m liegen, werden sich strategisch neu orientieren müssen, um unabhängiger vom klassischen Wintersportgeschäft zu werden. Das Interreg-Projekt «BeyondSnow» (2022–2025), finanziert im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP), unterstützt neun Wintertourismusdestinationen in sechs Alpenländern, die stark vom Schneemangel betroffen sind, bei diesem Wandel. Aus der Schweiz ist Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz als Pilotdestination mit dabei. Dort mussten 2023 aufgrund der schwierigen finanziellen Situation zwei von drei Schleppliften geschlossen werden. «Das ist natürlich eine sehr emotionale Geschichte» sagt Peter Niederer, Vizedirektor bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), welche das Projekt mitinitiiert hat. «Sattel-Hochstuckli ist eines der ältesten Skigebiete in den Voralpen und das Skifahren fester Teil der Tradition.» Lokale Akteure der Destinationen werden bei «BeyondSnow» konsequent eingebunden. So wurden in Sattel-Hochstuckli mit der lokalen Bevölkerung 22 Massnahmen erarbeitet, welche die Destination zukunftsfähig machen sollen. Im Fokus stehen dabei der Ganzjahrestourismus, Investitionen in Events und Kooperationen, sowie die Reduktion von Fixkosten. Gleichzeitig soll die Skiinfrastruktur trotzdem flexibel einsetzbar sein, wenn es die Schneebedingungen erlauben. Die teilnehmenden Skigebiete profitieren auch von einem Erfahrungsaustausch untereinander. So überlegt man in Sattel-Hochstuckli, einen Ultra Trail Event auf die Beine zu stellen, inspiriert von Métabrief (FR), einer anderen Destination, die bei «BeyondSnow» mit dabei ist. In Zukunft soll zudem ein öffentlich zugängliches, digitales Entscheidungswerkzeug entwickelt werden, welches auch anderen Tourismusdestinationen helfen soll, sich durch Neuausrichtung und Diversifikation proaktiv der veränderten Schneesituation anzupassen (SAB, 2024).

Interreg-Projekt: «TransStat»: Nachhaltiger Skitourismus für die Alpen von Morgen
Ein ähnliches Ziel wie «Beyond Snow» verfolgt das Interreg-Projekt «TransStat» (2022–2025), das mit neun alpinen Skidestinationen in fünf Ländern zusammenarbeitet. Mit diesen Destinationen wird ein Vorgehen erprobt, um gemeinsam mit lokalen Akteurinnen und Akteuren wünschenswerte Zukunftsszenarien für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen (Ski-)Tourismus zu entwickeln. Diese sollen als Grundlage für den Übergangsprozess der Skidestinationen dienen. Zu diesem Zweck entwickelt TranStat ein physisches und digitales Netzwerk von Orten im Wandel, um Wissen und Erfahrungen über die Zukunft auszutauschen. Ein weiteres Ziel ist es, politische Empfehlungen sowohl für den gesamten Alpenraum als auch für regionale Kontexte zu entwerfen.
Innotour-Projekt «Klimafitte Destinationen»: Ein ganzheitlicher Ansatz ist gefragt
Destinationen im Berggebiet sind von vielen weiteren Veränderungen durch den Klimawandel betroffen. Das Projekt «Klimafitte Destinationen» (2024–2026), unter der Trägerschaft von Graubünden Ferien und gefördert von Innotour, setzt daher auf eine ganzheitliche Betrachtung. «Wir möchten, dass unsere Destinationen die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel proaktiv angehen und sich so zukunftsfähig aufstellen», sagt Martina Hollenstein Stadler, Leiterin Nachhaltigkeit Graubünden Ferien. «Dabei geht es nicht nur um das allgegenwärtige Thema Schnee, sondern auch um weitere Chancen und Risiken, die der Klimawandel mit sich bringt». So werden die Sommer in den Städten und Agglomerationen des Mittellandes zunehmend heisser, weshalb Bergdestinationen vermehrt Gäste erwarten dürften, die Erholung von der Hitze suchen (Serquet & Rebetez, 2011). Jedoch ist durch intensiver werdende Starkniederschlagsereignisse auch vermehrt mit Überschwemmung und Murgängen zu rechnen. Das Projekt soll helfen, sicherzustellen, dass die teilnehmenden Destinationen ihr touristisches Geschäftsmodell so weiterentwickeln, dass es langfristig tragbar ist. » Für die drei teilnehmenden Pilotdestinationen im Kanton Graubünden (Lenzerheide, Engadin Samnaun Val Müstair und vorderes Prättigau) wurde analysiert, wie sie vom Klimawandel betroffen sind und welche prioritären Chancen und Risiken sich bieten. Gemäss Hollenstein hat das Projektteam mit den Destinationen eine «Roadmap Klimafitness» erarbeitet und wird die erste Umsetzungsphase begleiten. Martina Hollenstein betont: «Klimafit werden ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Daher sehen wir unsere Rolle darin, einen Prozess anzustossen der weit über das Ende der Innotour-Förderung hinaus geht.» Zentral für den längerfristigen Erfolg einer Destination dürfte auch sein, wie gut sie die sich bietenden Chancen nutzen kann.

Neue Regionalpolitik (NRP) unterstützt Projekte zur touristischen Neuausrichtung
Der Wandel kann auch eine Chance sein: Die Neue Regionalpolitik (NRP), welche von Bund und Kantonen gemeinsam finanziert wird, bietet Destinationen und Betrieben eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Chancen zu nutzen. Gefördert werden beispielsweise Machbarkeitsstudien für Projekte zur touristischen Neuausrichtung, wie für die Fideriser Heuberge im Prättigau. Auch die strategische Neuausrichtung von Bergbahnen, etwa der Wiriehornbahnen AG, kann durch die NRP unterstützt werden. Darüber hinaus stellt die NRP Mittel für die Planung konkreter Massnahmen zum Ausbau des Sommertourismus bereit, wie das Mountainbikeangebot der Destination Engelberg-Titlis, oder für ganzheitliche Tourismusstrategien, etwa in Kandersteg.
Der Klimawandel stellt den Tourismus in der Schweiz vor grosse Herausforderungen. Durch die beschriebenen Projekte, von welchen einige auch im neusten Insight, dem Innotour-Magazin, vorgestellt werden, unterstützt das SECO den Tourismussektor dabei, diese zu meistern. Neben der Projektförderung hat auch die Tourismuspolitik des SECO das Ziel, die Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, beispielsweise durch Wissensaufbau und -transfer im Rahmen des «Tourismus Forum Schweiz».
Innotour fördert die Innovation, Zusammenarbeit und den Wissensaufbau im Schweizer Tourismus. Innotour konzentriert die Förderung auf nationaler Ebene. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Mittel für Vorhaben mit nationaler Ausrichtung und für nationale Koordinationsaufgaben eingesetzt wird. Mit dem Instrument der Modellvorhaben werden jedoch auch regionale und lokale Vorhaben gefördert.
Interreg bietet die Möglichkeit für konkrete Projekte zur Weiterentwicklung der Regionen über Landesgrenzen hinweg. Die EU, die Nachbarländer, die Kantone, der Bund und Private finanzieren die Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen. Die Schweizer Teilnahme wird im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) finanziert. Die Bundesmittel stammen aus dem Fonds für Regionalentwicklung und sind für Projekte einzusetzen, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Regionen beitragen. Die Kantone können ihre Äquivalenzmittel hingegen auch in Projekte investieren, die nicht direkt der Erhöhung der Wertschöpfung oder der Entwicklung der regionalen Wirtschaft dienen.
Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützen Bund und Kantone das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum und die Grenzregionen in ihrer regionalwirtschaftlichen Entwicklung. Die NRP ist 2024 in ihre dritte achtjährige Mehrjahresperiode (2024–2031) gestartet. Die bisherigen thematischen Förderschwerpunkte «Industrie» und «Tourismus» werden weitergeführt. Neu können Kleininfrastrukturen unter bestimmten Voraussetzungen mit A-fonds-perdu-Beiträgen unterstützt werden. Als Querschnittsthemen erhalten neben der «lokalen Wirtschaft», welche die Exportorientierung der NRP ergänzt, die nachhaltige Entwicklung und die Digitalisierung besonderes Gewicht.
Links und Quellen
MeteoSchweiz, 2024. Klimaindikatoren.
NCCS, National Centre for Climate Services, 2024. CH2018 – Klimaszenarien für die Schweiz.
Schweiz Tourismus, 2024, Winter und Klimawandel.
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB), 2024. Projekt Beyond Snow.
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, 2024, Innotour – Geförderte Projekte.
Graubünden Ferien, 2024. Projekt Klimafitte Destinationen, letzter Zugriff: 15.12.2024.
Wissenschaftliche Literatur
Serquet, G., Rebetez, M. Relationship between tourism demand in the Swiss Alps and hot summer air temperatures associated with climate change. Climatic Change 108, 291–300 (2011). https://doi.org/10.1007/s10584-010-0012-6