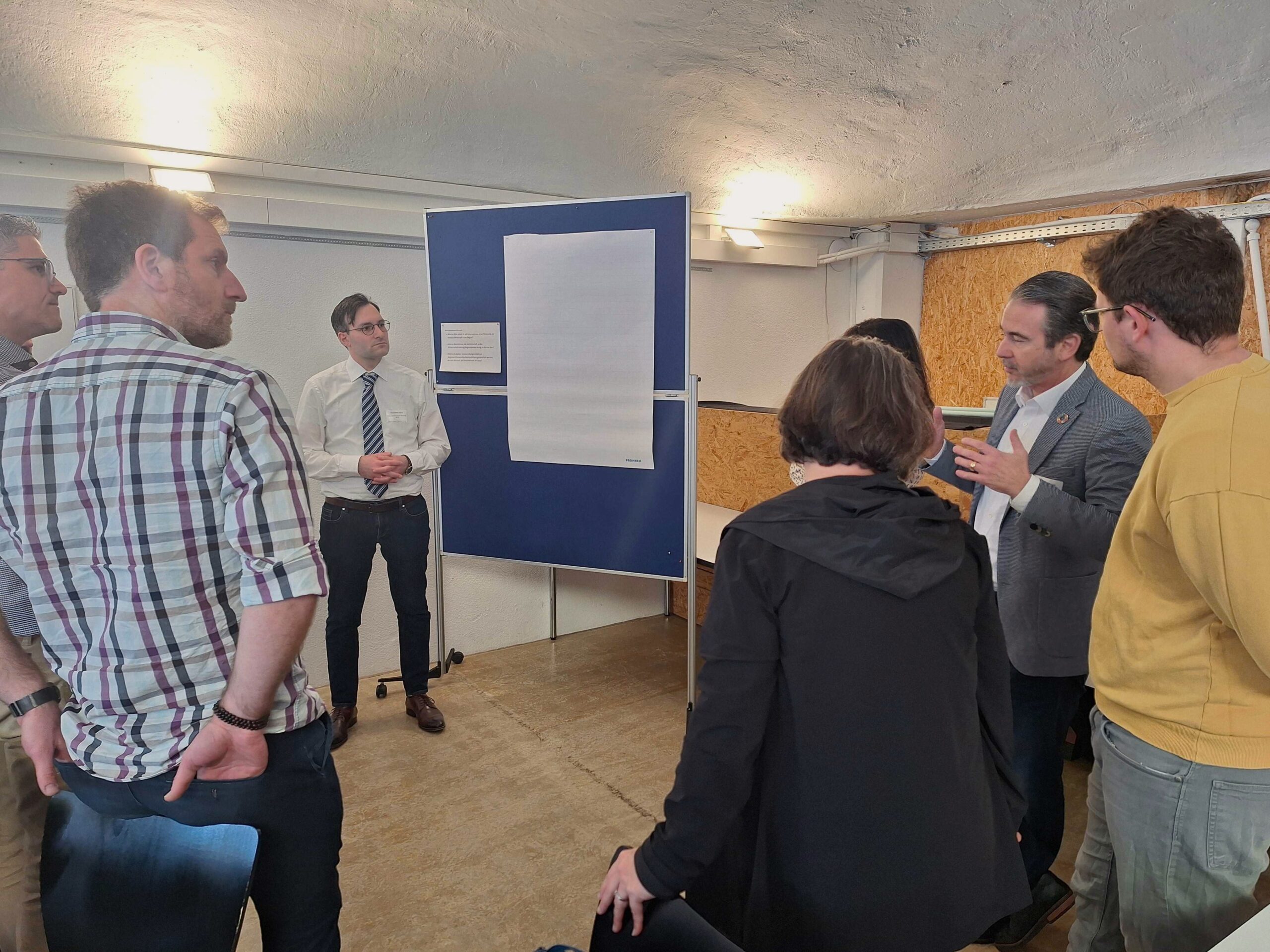An der diesjährigen regiosuisse-Konferenz war der Gastgeberkanton Thurgau mit exzellenten Beispielen regionaler Wertschöpfung präsent. Lassen Sie sich inspirieren!
Bereits mit der Ankunft in der Kartause Ittingen tauchten die Teilnehmenden ins Thema der diesjährigen regiosuisse Konferenz ein: «Das Potential regionaler Wertschöpfung nachhaltig gestalten». Die Kartause ist ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung, liegt idyllisch über dem Thurtal und war als ehemaliges Kloster schon seit Jahrhunderten an der regionalen Wertschöpfung beteiligt. Es wurde dank des Weinbaus reich. Heute ist es für die Stiftung Kartause Ittingen deutlich anspruchsvoller, die notwendigen Mittel für die Betriebe und den Unterhalt der historischen Klosteranlage zu erwirtschaften. Die Kartause besteht nicht nur aus einem Seminarzentrum mit Restaurant, sondern auch aus einem Gutshof, zwei Museen, einer Institution für betreutes Wohnen und Arbeiten sowie einem Zentrum für Spiritualität. Die Stiftung setzt bewusst auf Selbstversorgung und lokale Nachhaltigkeit. So liegt der Selbstversorgungsgrad des Restaurants bei sage und schreibe 57 Prozent.

Von der internen Wertschöpfung zur regionalen Wertschöpfungskette
Mark Ziegler, Procurator der Stiftung hielt in seiner Begrüssungsrede fest: «Nachhaltigkeit und Selbstversorgung sind nicht günstig. Deshalb setzen wir neu auf Zusammenarbeit in der ganzen Region, zum Beispiel beim Keltern oder bei der Schweinezucht. Zusammen mit regionalen Partnern können wir die Wertschöpfung steigern.» Das Credo der Kartause verändert sich gerade: Von der internen Wertschöpfung hin zur Stärkung von regionalen Wertschöpfungsketten. Dank Kooperationen mit den passenden regionalen Partnern können Kosten reduziert werden, ohne dass Kompromisse bei der Qualität oder der Nachhaltigkeit eingegangen werden müssen.


Standortattraktivität und Tourismus in Frauenfeld
Die Hauptstadt des Thurgaus war mit zwei Beispielen an der regiosuisse-Konferenz vertreten, bei denen es um die Standortqualität ging: Einerseits wurde das Street-Art-Festival Frauenfeld als Motor regionaler Wertschöpfung vorgestellt. Anderseits rückte die Stadtkaserne Frauenfeld in den Fokus. Die ehemals vom Militär genutzten Gebäude öffnen sich für die Bevölkerung, auf dem Areal wird gemeinsam Neues geschaffen. Dafür wurde eine partizipative Entwicklung angestossen. Die Neue Regionalpolitik von Bund und Kanton unterstützte das Projekt mit einer Machbarkeitsstudie für einen künftigen «Markt Thurgau», der in der Stadtkaserne ein innovatives Schaufenster für Thurgauer Produkte, Dienstleistungen und Ideen werden soll. Mit der Umsetzung des Markt Thurgau soll die Stadtkaserne über den Kanton und die Stadt hinaus Publikum anziehen. Damit wird sie zu einem Treffpunkt mit überregionaler Ausstrahlung.
Bei beiden Projekten zeigte sich: Innovative Projekte, die mit und für die Bevölkerung entwickelt werden, tragen zur Attraktivität eines Standorts und zur regionalen Wertschöpfung bei.
Natürlich wirksam am Bodensee
An Konferenz wurde ein weiteres innovatives Projekt präsentiert: die Schaffung eines Schweizer Branchenclusters für Phytomedizin am Bodensee. Das «PhytoValley» bringt die wirtschaftliche Relevanz der hiesigen Naturmedizin-Branche zum Ausdruck. Beteiligt sind Firmen wie A. Vogel, Zeller, Rausch oder hepart. Der Cluster fördert die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Unternehmen und Organisationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Phytomedizin sowie mit der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung.
Sein Fokus liegt primär auf zwei Bereichen: Erstens auf der Gewinnung und Ausbildung von Fachkräften und zweitens auf der Stärkung der Attraktivität der Region durch eine nachhaltige Entwicklung der Naturmittelproduktion mittels innovativer Technologien.

Für Walter Schönholzer, Regierungsrat des Kantons Thurgau, ist der Aufbau des «PhytoValley» ein ausgezeichnetes Beispiel für die positive Wirkung der Neuen Regionalpolitik (NRP).
«Gerade wenn die Mittel von Kanton und Bund knapper werden, ist die Fokussierung auf gewisse Kernthemen in unserem eher strukturschwachen Kanton sehr wichtig. Dank der NRP-Gelder können wir zum Beispiel den Schweizer Branchencluster «PhytoValley» umsetzen und die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern.»
Die regiosuisse-Konferenz ist nationaler Treffpunkt für alle, die in der Regionalentwicklung tätig sind. Die im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) organisierte Konferenz widmet sich jeweils einem aktuellen Thema der Regionalentwicklung. 2025 fand die Konferenz in der Kartause Ittingen statt, im Mittelpunkt stand das Potenzial regionaler Wertschöpfung.
Quelle Fotos: © Timo Kellenberger