Viele ländliche Regionen suchen nach Wegen, wie sie ihre Zukunft gestalten können. Es geht oft um Themen wie Abwanderung, Arbeitsmöglichkeiten, Gesundheits- und Güterversorgung. Wie sollen diese Bereiche nachhaltig und zukunftsgerichtet angegangen werden? Die Region Albula mit rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat diese Fragen in drei Workshops öffentlich diskutiert. Der Geschäftsführer und Regionalentwickler Mirko Pianta erzählt, wie er dieses partizipative Vorgehen erlebt hat und was daraus entsteht.
«Die an den Diskussionen beteiligten brachten ein breites Spektrum von Meinungen und Ideen ein.»
Geschäftsführer und Regionalentwickler Mirko Pianta


regiosuisse: Die Regionalentwicklung ist ihr Fachgebiet. Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich in der Region Albula konfrontiert?
Mirko Pianta: Das Gebiet liegt im Zentrum Graubündes, unweit der Hauptstadt Chur und der grossen touristischen Destinationen Oberengadin und Davos. Schon das alleine – und dass deshalb rund zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr die Region durchqueren – ist eine Herausforderung. Es wäre wünschenswert, wenn wir einen Bruchteil davon in der Region behalten und wirtschaftlich davon profitieren könnten. Innovation ist deshalb auch hier gefragt. Was an der Region Albula besonders interessant ist, ist die Vielfalt der Kulturen, da hier drei Subregionen mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Traditionen zusammenkommen. Es handelt sich dabei um die Subregionen Surses, in der man hauptsächlich rätoromanisch spricht sowie die Regionen Albulatal und Lenzerheide mit Deutsch und Rätoromanisch. Aufgrund der teils grossen Distanzen sind sie mehrheitlich wirtschaftlich autonom. Trotzdem einen gemeinsamen Nenner zu finden, der den regionalen Interessen gerecht wird und die individuellen Bedürfnisse und Autonomie fördert, ist ein spannender Prozess.
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) haben Sie kürzlich im Rahmen eines europäischen Projekts zu einem zweiteiligen partizipativen Workshop eingeladen. Es ging um Ideen, wie die Standortqualität in der Region noch verbessert werden kann. Zwanzig Personen diskutierten dazu. Was waren die «brennendsten Themen»?
Das bewegendste Thema war der fehlende Wohnraum, der mitunter auch ein Grund ist, dass die Bevölkerungszahlen rückläufig sind. Das zweite war die Gesundheitsversorgung und die damit verbundene Befürchtung, dass beispielsweise Physiotherapeuten, Psychologinnen oder andere Spezialisten in wirtschaftsstärkere Regionen wegziehen.
Welche Anliegen waren für Sie neu?
Ein Bedürfnis, das mir vorher nicht bekannt war, ist der Wunsch nach einer zentralen Informationsplattform. Die Idee ist, dass alle Veranstaltungen der Region, Angebote und Kurse aller Art oder touristische Angebote vereint zu finden sind. Eine solche Plattform wäre sowohl ein Gewinn für Einheimische als auch für Gäste. Ausserdem kam der Wunsch nach kreativen Begegnungsorten auf oder die Idee, einen Markt für den Verkauf regionaler Produkte zu veranstalten.
Was war Ihres Erachtens der grösste Gewinn dieses partizipativen Vorgehens?
Die Beteiligung der Menschen an diesen Diskussionen und die Ideen, die zusammengetragen wurden. Denn sie brachten ein breites Spektrum an Meinungen ein. Besonders daran war, dass wir zusätzlich zu den Einheimischen auch Zweitheimische und Personen, die in die Region pendeln, eingeladen haben, um mitzudiskutieren. Sie brachten eine gewisse Aussensicht ein und wir konnten auch auf ihre Anliegen eingehen.

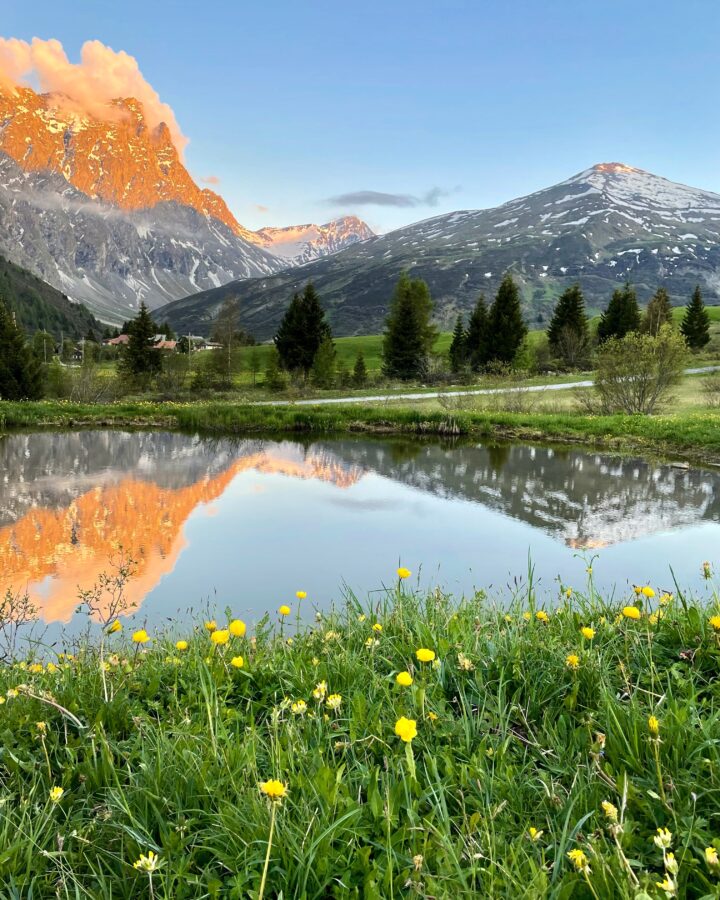
Was hingegen konnte mit diesem Vorgehen nicht erreicht werden?
Gewisse Anliegen sind sehr komplex, es geht da auch um Rechtliches und um Politik. Gerade im Bereich Wohnungssituation: Wir haben dazu Ideen ausgetauscht, z.B. über die Möglichkeit, Wohnbaugenossenschaften zu gründen. Doch gewisse gesetzliche Grundlagen schränken unseren Handlungsspielraum ein. Es gibt beispielsweise die gesetzliche Vorgabe, dass eine Gemeinde bei einer kontinuierlichen Abwanderung Bauparzellen reduzieren muss. Wie kann so neuer Wohnraum in einer Abwanderungsregion entstehen?
Gibt es Ideen oder Vorschläge aus den Diskussionsrunden, die trotzdem und schon jetzt umgesetzt werden können?
Ja, wir arbeiten bereits dran. Im Herbst 2025 werden wir beispielsweise die erste Berufsschau veranstalten, um die Arbeitgeberattraktivität zu fördern. Diese zeigt angehenden Lehrlingen auf, welche Ausbildungen sie in der Region machen können. So erreichen wir, dass Junge in der Region bleiben oder gar Jugendliche von Zweitwohnungsbesitzern sich entscheiden, hier eine Lehre zu machen. Mit einer Impulsveranstaltung für Arbeitgeber wollen wir aufzeigen, wie Jobs in hiesigen Betrieben attraktiv gestaltet und anpriesen werden können.
Welche Ideen könnten dazu führen, die Lebensqualität und die Versorgung in Ihrer Region langfristig weiter zu verbessern?
Unbestritten das Thema Wohnraum für Einheimische. Dieses hat einen grossen Einfluss darauf, ob eine Region attraktiv bleibt und so der Abwanderung entgegengewirkt werden kann. Unsere Jugend soll Möglichkeiten haben, hier zu arbeiten und wirtschaftlich tätig zu sein. Gleichzeitig müssen auch wirtschaftlich relevante Infrastrukturen geschaffen werden, etwa mit der Zonenplanung und der Netzwerkinfrastruktur.
Was möchten Sie als Regionalentwickler in 10 Jahren in der Region Albula erreicht haben?
Unsere Vision haben wir für eine längere Periode entwickelt. 2050 möchten wir ein Bevölkerungswachstum von 10 Prozent erreicht haben. Es soll dann auch 10 Prozent mehr Arbeitsplätze geben. Darauf arbeiten wir hin. Mit den in den Workshop diskutierten Themen und der angestrebten Umsetzung sind wir sicher auf einem guten Weg. Dafür setze ich mich gerne weiterhin ein.
Besten Dank für das Gespräch.
Die Workshops in der Region Albula wurde im Rahmen des ESPON-Projekts RURALPLAN durchgeführt – ein Projekt, das für ländliche Regionen ohne demografisches Wachstum Strategien für deren Entwicklung erforscht. Das Projekt in der Region Albula wurde via das EU-Programm ESPON (European observation network for territorial development and cohesion) mit Geldern der Neuen Regionalpolitik (NRP) mitfinanziert.



